Der kleine Prinz in Las Vegas
Inhaltsangabe
Unsichtbare Qualitäten jedes Menschen werden mit den Augen des Kleinen Prinzen sichtbar gemacht: Erinnerungen an Möglichkeiten, die den spielenden und technisch orientierten Menschen (homo ludens und homo faber) miteinander versöhnen.
Der Autor erinnert dazu an die schöpferischen Möglichkeiten, die in jedem von uns vorhanden sind und beschreibt, wie sich unsere spielerische Intelligenz, wenn wir sie nur zulassen, auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt: auf unsere Zukunftspläne, unsere Arbeit und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Anhand von Fallgeschichten und alltäglichen Erfahrungen zeigt Eckhard Schiffer, wie wir spielerische Intelligenz auch nutzen können, um Krankheit, Resignation und emotionaler Leere zu entgehen.
Der Psychotherapeut und Arzt Eckhard Schiffer erinnert in seinem neuen Buch an die spielerisch schöpferischen Möglichkeiten, die in jedem Menschen vorhanden sind. Anhand von Fall-beispielen aus seiner eigenen Praxis und alltäglichen Erfahrungen beschreibt er, wie wir die emotionale Leere füllen können, die unser Dasein und unsere Gesellschaft zunehmend bedroht.
Der Druck, den eine von Konkurrenzmentalität bestimmte Gesellschaft auf uns alle ausübt, nimmt immer mehr zu. Und immer mehr Menschen finden keine andere Lösung, als sich in Krankheit, Sucht oder Resignation zu flüchten, um der inneren Leere, zu entkommen. Spielerische Intelligenz, die ein entscheidendes Humanum darstellt, bleibt dabei auf der Strecke.
Um den spielenden und technisch orientierten Menschen (homo ludens und homo faber) zu versöhnen, entwirft der Autor konkrete Utopie einer menschlicheren Gesellschaft als Gegenentwurf zu einer Welt, die von Gewalt und zunehmender Verrohung gekennzeichnet ist. Er will unsichtbare Qualitäten jedes Menschen mit den Augen des kleinen Prinzen sichtbar machen, Erinnerungen an Möglichkeiten, die »uns guttun«.
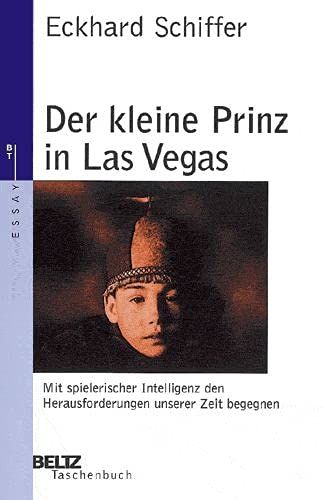
Bestellung
Schiffer, E.: "Der kleine Prinz in Las Vegas"
Verlag: Beltz Verlag, 2001, Weinheim.Basel
229 Seiten, Euro 13
Rezensionen
»Schiffers Erörterungen sind in hohem Maße konstruktiv - bereits durch die Art und Weise, wie er sein Wissen und seine Kritik dem Lesepublikum vermittelt: das wissenschaftliche Niveau wahrend und populär in der Darstellung ... Eine anregende, sogar fesselnde Lektüre.«
Spielerische Intelligenz gegen Krankheit und Resignation
Dies ist ein erfrischender, aufmunternder Ansatz, wie die in uns allen steckenden schöpferischen Möglichkeiten mobilisiert werden können. Nicht durch gewinnorientiertes Spiel oder frappierende Technik, wie z. B. in den Kasinos von Las Vegas, sondern durch innovativ-schöpferische Möglichkeiten sollen Erwachsene ihre Resignationen und Depressionen erkennen und bearbeiten lernen. Mit den Fragen und Erklärungen, die Antoine de Saint-Exupery in seinem Buch "Der kleine Prinz" stellt und gibt, versucht der analytisch orientierte ärztliche Psychotherapeut Eckhard Schiffer diesen Problemen näherzukommen.
Er findet durch die Aktivierung der spielerischen Intelligenz einen Ausweg aus der Sackgasse, in der sich z.B. der Trinker im kleinen Prinzen befindet: "Warum trinkst Du?", fragt ihn der kleine Prinz. "Um zu vergessen", antwortet der Säufer. "Um was zu vergessen?", erkundigt sich der kleine Prinz. "Um zu vergessen, dass ich mich schäme", gestand der Säufer und senkte den Kopf. "Weshalb schämst Du Dich?", fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. "Weil ich saufe!"
Nicht das Erleiden einer Situation - auch im Spiel - sondern das Mitgestalten stehen im Vordergrund. Es werden das Spielen als "play" - als Prozess -und als "match" - bei dem der Gegner ausgeschaltet wird - gegenübergestellt.
Der Autor fordert zum Spielen, Malen, zum kreativen Gestalten der Urnwelt und zur sanften Rebellion gegen den Aberglauben auf, dass die Dinge so sind, wie sie sind.
Schon unsere Kinder möchte er nicht vor ihren PCs verkümmern, sondern sie ihre Umwelt mitgestalten sehen.
Der Leser wird aufgefordert, seine spielerische Intelligenz zu aktivieren, die sich auf alle Lebensbereiche positiv auswirken kann: auf die Zukunftspläne, auf die Arbeit und auf die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ein Buch für Eltern und Erzieher, für Therapeuten und alle, die sich aufs Spielen einlassen können und wollen.
Spielerische Intelligenz als Suchtprophylaxe
Rainer Buland
Spielforschung aktuell, Nr. 13, 1998 4. Jahrgang
Das Spiel soll eine Maßnahme sein, der Spielsucht vorzubeugen? Und das wird ernsthaft von einem Arzt und Therapeuten vorgetragen!? Wie kommen wir mit diesen Widersprüchen zurecht? Das Spiel, das hier gemeint ist, und das vorbeugend vor verschiedenen Suchler-scheinungen zu bewahren hilft, beschreibt Eckhard Schiffer folgendermaßen:
Spielen wird hier als Urform des schöpferischen Handelns verslanden. (...) Zu diesem Spielen gehört auch innehalten und betrachtend verweilen zu können. Welt gestalten und wahrnehmen. (...) Mit den Grundformen des Spielens ist ein kindliches Spielen gemeint, bei dem das Spielgeschehen selbst schon wichtig ist und nicht erst das vorweisbare Ergebnis.' (S.8-9).
Die Gestaltungs-Spiele, die hier gemeint sind, werden häufig auch als das .ursprüngliche Spielen' bezeichnet, oder auch .das Spiet der Kinder*. Worum es dabei geht, und wie dies prophylaktisch und therapeutisch wirksam werden kann. hat Eckhard Schiffer so beschrieben:
Las Vegas ist überall: Symbol einer Wüstenlandschaft, in der Spiel und Technik den Menschen zerstören.' (S.B) .Damit Spiel und Technik den Menschen nicht zerstören, bedürfen wir des Spielens. (...) Es geht um die Lust spielerischen Er-kundens und Ausprobierens. Es geht dabei gleichzeitig um die Erfahrung der eigenen Kompetenz. Und gerade diese Erfahrung ist ganz wesentlich für eine wichtige menschliche Fähigkeit, nämlich hoffen zu können. (...) Fehlt Hoffnung als kundige Hoffnung, d.h. als das Wissen um die eigene schöpferische Kompetenz, dann geht gerade in schwierigen Zeiten oft eine gefährliche Schere auf. Nämlich die zwischen einem gegenwartstypischen innerlichen Erfolgszwang und dem nur mangelhaft ausgeprägten Zutrauen in die eigene Kompetenz. Die daraus resultierenden inneren Spannungen führen immer wieder geradewegs zur Sucht und/oder Gewatt, insbesondere bei Jugendlichen. Auch werden dadurch Depressionen, bzw. der Ausbruch anderer Krankheiten begünstigt. Und die Lust am spielerisch-neugierigen Erkunden und Ausprobieren ist noch für eine weitere, der Hoffnung und Neugierde benachbarte menschliche Eigenschaft eine wesentliche Voraussetzung, nämlich für das Interesse.' (S.21-22)
In 16 sehr leicht zu lesenden und mit vielen Beispielen aus der therapeutischen Praxis versehenen Kapiteln führt Schiffer diesen zentralen Gedanken weiter aus. Das Buch ist eine gute Quelle für alle Erzieher. Pädagogen und Therapeuten, die in irgendeiner Weise mit den Suchtproblemen Jugendlicher zu tun haben, oder prophylaktisch arbeiten wollen und sollen. Auch für die Therapie Erwachsener sind Anregungen zu holen, schlielilich ist es therapeutisch überaus hilfreich, zum eigenen Spiel zurückzufinden. Denn, wer nicht mehr spielen kann in diesem ursprünglichen Sinn, wer darin behindert wurde, und sich in der Folge selbst darin behindert hat, läuft Gefahr, in eine erstarrte und unflexible Haltung zu verfallen. dadurch zu wenig Verhaltensalternativen, zu wenig Freiheit zur Problembewäl-tigung zur Verfügung zu haben, und letztlich in einer einzigen Verhaltensweise Zuflucht nehmen zu müssen, die sich dann nur allzu oft als eine Suchterscheinung erweist.
Spielen ist keine Spielerei, es kann gefährlich sein und heilend.
Bücherbar, SDR l jeden Sonntag von 20,05 Uhr bis 22,00 Uhr
Rezensent: Ellinor Krogmann Datum: 13.12.97
Moderator:
"Der kleine Prinz in Las Vegas" ist ein Sachbuch, das im weitesten Sinne in die Rubrik "Psycho" gehört. Der Autor Eckhard Schiffer ist Psychotherapeut und Arzt und im Untertitel verrät er, um was es ihm geht, um "Spielerische Intelligenz gegen Krankheit und Resignation". Ellinor Krogmann hat das Buch gelesen und es ist ihr Weihnachtstip.
Ellinor Krogmann:
Schiffers Buch ist ein Plädoyer für das Spielen im Alltag. Nicht für verbissenen Erfolgs-Fußball oder das Spiel am einarmigen Banditen. Er unterscheidet das "match" vom "play". Er meint das Spiel, bei dem das Ziel nicht so wichtig ist, er meint das kindliche Spielen, bei dem das Spielgeschehen viel entscheidender ist als das Ergebnis. Wettbewerb und Konkurrenz haben wir genug, sagt Schiffer, was wir ziemlich schnell verlernen, ist, daß Spielen lustvoll und heilsam sein kann. Eckhard Schiffer schöpft aus seiner medizinischen und psychotherapeutischen Erfahrung, erzählt von Menschen, die schon in ihrer Kindheit verlernt haben, einfach mal was auszuprobieren, ohne genau zu wissen, wohin es führt. Als Erwachsene sind sie vor allem mit der Kontrolle ihres Lebens beschäftigt. Das Buch ist aber kein Ratgeber, es sagt nie: Frau A hat es immer so gemacht, aber so wäre es doch viel besser gewesen. Es ist eine Betrachtung, die ins Philosophische geht, auch auf andere Bücher, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, verweist.
Auf Philosophen wie Ernst Bloch oder Peter Sloterdijk. Aber Schif fer stützt sich sympathischerweise auch noch auf ganz andere literarische Quellen, um seine Thesen zu illustrieren. Zum Beispiel auf Pippi Langstrumpf oder auf den kleinen Prinzen wie der Titel schon sagt.
Der kleine Prinz, eine literarische Figur, die Antoine de Saint-Exupery geschaffen hat, hat besondere Augen, eine besondere Phantasie, die befreiend wirkt. Schiffer versucht, das in den Alltag zu übersetzen. Berichtet wie befreiend und belebend es für eine Beziehung sein kann, wenn einer oder eine sich traut, mal über Träume, Erinnerungen oder Phantasien zu sprechen.
Im Gespräch aus dem "Das Leben am Funktionieren halten" auszubrechen. Der "Homo faber", der zweckmäßig denkende und handelnde Mensch braucht den "Homo ludens", den spielenden. Schiffer ist davon überzeugt, daß die spielerische Intelligenz, wenn wir ihr mehr Raum geben, unser Leben positiv verändert. Sein Buch Ist genau , aber nie belehrend. Er läßt uns an seinen Überlegungen teilhaben, ohne einzuschüchtern.